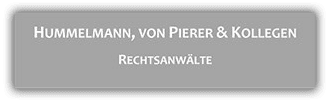Unterhalt während der Ausbildung – Infos für Eltern & Azubis
Eltern sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Kindern eine angemessene Ausbildung zu ermöglichen – und zwar nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Doch was bedeutet das konkret für Auszubildende, Studierende und deren Eltern? Wer muss wann und wie viel zahlen? Und wie lange besteht überhaupt ein Anspruch auf Unterhalt während der Ausbildung? Im folgenden Beitrag klären wir die wichtigsten rechtlichen Grundlagen und praktischen Fragen.
Inhaltsverzeichnis
Sie suchen einen erfahrenen Anwalt für Familienrecht? Fachanwalt für Familienrecht Peter-Axel-Hummelmann steht an Ihrer Seite.
Erfahrene Anwälte aus Erlangen - Kanzlei Hummelmann, von Pierer & Kollegen
Top bewertet! 

Kontakt aufnehmen für eine schnelle Hilfe!
Wann besteht Anspruch auf Unterhalt?
Der Anspruch auf Unterhalt während der Ausbildung ergibt sich aus § 1601 BGB. Danach sind Verwandte in gerader Linie – also insbesondere Eltern – einander zum Unterhalt verpflichtet. Dieser Anspruch besteht grundsätzlich bis zum Abschluss einer ersten berufsqualifizierenden Ausbildung. Entscheidend ist dabei, dass die Ausbildung zielstrebig und ernsthaft betrieben wird. Ob es sich um eine betriebliche Lehre, eine schulische Ausbildung oder ein Studium handelt, spielt dabei keine Rolle.
Wichtig: Der Unterhaltsanspruch besteht unabhängig vom Alter des Kindes. Es ist also nicht entscheidend, ob das Kind minderjährig oder bereits volljährig ist, solange sich das Kind in der ersten Ausbildung befindet und diese zielstrebig verfolgt.
Wie hoch ist der Unterhalt?
Die Höhe des Unterhalts richtet sich in der Praxis nach der sogenannten Düsseldorfer Tabelle. Sie stellt eine bundesweit anerkannte Leitlinie dar, an der sich Gerichte und Anwälte bei der Bemessung des Kindesunterhalts orientieren. Die Höhe des Anspruchs hängt dabei insbesondere vom Einkommen der unterhaltspflichtigen Eltern sowie vom Alter des Kindes ab.
Bei minderjährigen Kindern, die noch im Haushalt eines Elternteils leben, richtet sich der Bedarf nach der jeweiligen Altersstufe. Bei volljährigen Kindern, die ebenfalls noch zuhause wohnen, beträgt der monatliche Bedarf aktuell rund 625 Euro (Stand: 2025). Wohnt das Kind hingegen nicht mehr bei den Eltern, etwa weil es in einer eigenen Wohnung lebt, wird in der Regel ein pauschaler Bedarf von 930 bis 1.050 Euro angenommen. Darin enthalten sind insbesondere Kosten für Unterkunft, Ernährung, Kleidung, Studienmaterial und Freizeit.
Wer muss zahlen?
Leben die Eltern getrennt oder sind sie geschieden, so sind beide Elternteile anteilig unterhaltspflichtig – und zwar im Verhältnis ihrer jeweiligen Einkünfte. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, erbringt in der Regel bereits Naturalleistungen durch Unterkunft und Verpflegung und muss daher nur eingeschränkt baren Unterhalt zahlen. Der andere Elternteil muss dann den sogenannten Barunterhalt leisten.
Bei volljährigen Kindern, die nicht mehr im elterlichen Haushalt leben, müssen hingegen beide Elternteile grundsätzlich Barunterhalt leisten. Auch hier erfolgt die Aufteilung des Unterhaltsanspruchs entsprechend dem Verhältnis ihrer Einkommen.
Was ist mit Ausbildungsvergütung oder BAföG?
Hat das Kind während der Ausbildung eigene Einkünfte, zum Beispiel durch eine Ausbildungsvergütung oder durch BAföG-Leistungen, wird dies auf den Unterhaltsanspruch angerechnet. Allerdings bleibt ein Teil der Ausbildungsvergütung anrechnungsfrei – in der Regel etwa 100 Euro monatlich – da dieser Betrag als berufsbedingter Mehraufwand angesehen wird. Nur der darüber hinausgehende Betrag wird auf den Bedarf angerechnet.
Auch BAföG wird grundsätzlich berücksichtigt, insbesondere dann, wenn es als Vollzuschuss und nicht als Darlehen gewährt wird. Kindergeld, das in der Regel bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gezahlt wird, wird ebenfalls auf den Unterhaltsbedarf angerechnet, da es dem Kind zugutekommt.
Wie lange müssen Eltern zahlen?
Die Unterhaltspflicht besteht grundsätzlich bis zum Abschluss der ersten Ausbildung. Dabei ist nicht immer eindeutig, was als „erste Ausbildung“ gilt. Eine Lehre mit anschließendem Studium kann beispielsweise dann als einheitliche Ausbildung gewertet werden, wenn ein fachlicher Zusammenhang besteht und die weiterführende Ausbildung zeitnah aufgenommen wird. Auch ein Bachelor- und anschließender Masterabschluss können als einheitliche Ausbildung gelten.
Kommt es während der Ausbildung zu einem Wechsel – etwa bei einem Studienabbruch oder einer Neuorientierung – verlieren Kinder ihren Anspruch auf Unterhalt nicht automatisch. Allerdings sind sie verpflichtet, die Ausbildung zügig und zielstrebig fortzuführen. Verzögerungen oder mehrfaches Wechseln ohne nachvollziehbare Gründe können dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch entfällt. Die Gerichte prüfen hier stets im Einzelfall, ob ein „mutwilliges“ Verhalten des Kindes vorliegt.
Was passiert bei geringem Elterneinkommen?
Eltern sind nur insoweit unterhaltspflichtig, wie es ihnen wirtschaftlich zumutbar ist. Das Gesetz sieht daher sogenannte Selbstbehaltssätze vor – also Mindestsummen, die den Eltern verbleiben müssen, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Aktuell liegt dieser Selbstbehalt bei etwa 1.450 Euro für erwerbstätige Elternteile. Liegt das Einkommen darunter oder nur knapp darüber, kann sich die Unterhaltspflicht entsprechend verringern oder ganz entfallen.
Gleichzeitig besteht jedoch eine Erwerbsobliegenheit der Eltern: Wer arbeitslos ist oder in Teilzeit arbeitet, obwohl er in der Lage wäre, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen, muss sich unter Umständen ein fiktives Einkommen anrechnen lassen. Auch hier gilt: Die tatsächlichen Lebensverhältnisse sind entscheidend.
Was ist mit Nebenjobs des Kindes?
Auch das Kind selbst ist verpflichtet, seinen Lebensunterhalt im Rahmen des Zumutbaren mitzutragen. Das bedeutet: Ein Nebenjob während der Ausbildung oder des Studiums kann erwartet werden – zumindest in zeitlich angemessenem Umfang. Vollzeitjob oder Selbstständigkeit sind hingegen in der Regel nicht erforderlich oder gar unzulässig, da sie den Ausbildungserfolg gefährden könnten. Die Einkünfte aus Nebenjobs werden wie die Ausbildungsvergütung anteilig auf den Bedarf angerechnet.
Was tun bei Streit?
Nicht selten kommt es zwischen Eltern und Kindern oder zwischen getrenntlebenden Elternteilen zu Streitigkeiten über die Höhe des Unterhalts oder über die grundsätzliche Zahlungspflicht. In solchen Fällen empfiehlt es sich, frühzeitig anwaltlichen Rat einzuholen. Ein Anwalt kann nicht nur helfen, die Unterhaltshöhe korrekt zu berechnen, sondern auch klären, ob und in welchem Umfang eigene Einkünfte des Kindes oder staatliche Leistungen auf den Bedarf anzurechnen sind.
Darüber hinaus kann anwaltliche Unterstützung hilfreich sein, wenn eine einvernehmliche Regelung mit dem anderen Elternteil nicht gelingt oder wenn es darum geht, einen bestehenden Anspruch gerichtlich durchzusetzen oder abzuwehren.
Hilfe vom Anwalt bei Fragen zum Unterhalt während der Ausbildung
Die Frage nach dem Unterhalt während der Ausbildung ist komplex – sowohl rechtlich als auch in der praktischen Umsetzung. Eltern sind grundsätzlich verpflichtet, ihre Kinder bis zum Abschluss der ersten Ausbildung finanziell zu unterstützen. Die genaue Höhe des Unterhalts hängt von vielen Faktoren ab, etwa dem Einkommen der Eltern, der Art der Ausbildung, dem Wohnsitz des Kindes und dessen eigenen Einkünften. Sowohl Eltern als auch Auszubildende sollten sich frühzeitig informieren, um Streitigkeiten zu vermeiden und eine faire Lösung zu finden.
Sie haben Fragen zum Ausbildungsunterhalt oder benötigen Unterstützung bei der Berechnung oder Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen?
Gerne beraten wir Sie in Erlangen und darüber hinaus kompetent und praxisnah. Kontaktieren Sie uns für ein persönliches und individuelles Beratungsgespräch.
Erfahrene Anwälte aus Erlangen - Kanzlei Hummelmann, von Pierer & Kollegen
Top bewertet! 

Kontakt aufnehmen für eine schnelle Hilfe!